

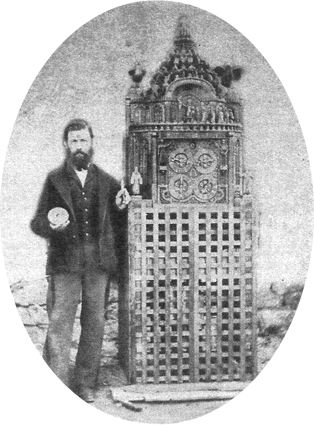
|
Karl Ketterer, Mechaniker in St.Peter |
| Joseph Ludolph Wohleb |
 |
 |
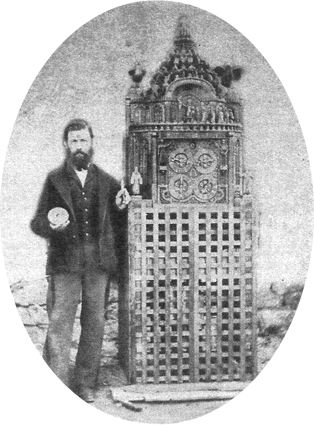 |
| Karl Ketterer - Oelstudie nach dem Leben von A.G. Knittel Freiburg |
Kreuz im "Engel" (Sägendobel) |
Ketterers Wunderuhr |
 |
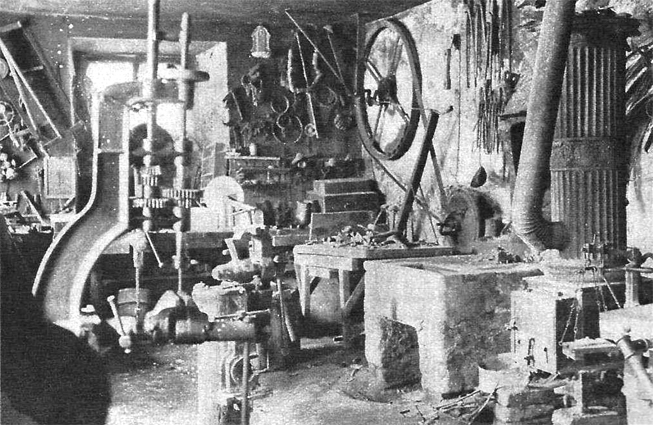 |
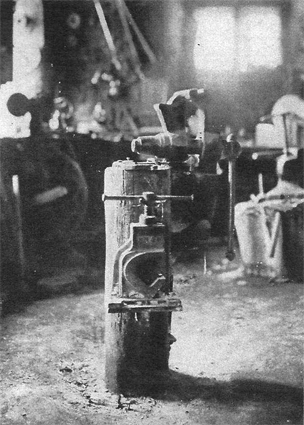 |
| Ketterers Haus am Steig in St.Peter Aufnahme: Emil Engel, Freiburg |
Ketterers Werkstatt Aufnahme: Emil Engel, Freiburg |
Der Amboss |