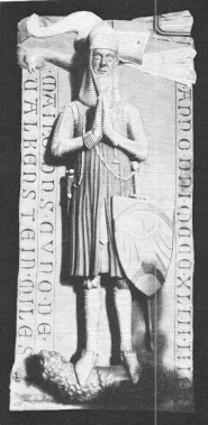
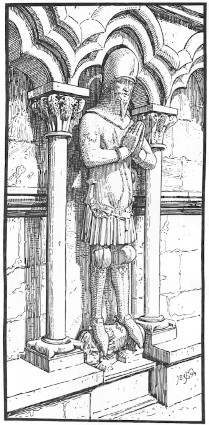


Kuno von Falkenstein
in der Kirche zu Kirchzarten
Freiburg i.Br.
der Gimbel´schen Waffensammlung
(Baden-Baden) rekonstruiert
der Gimbel´schen Waffensammlung
(Baden-Baden) rekonstruiert
|
|
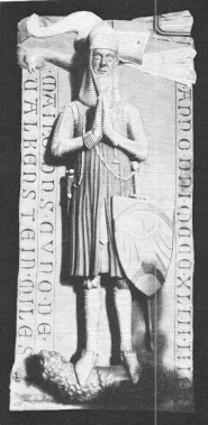 |
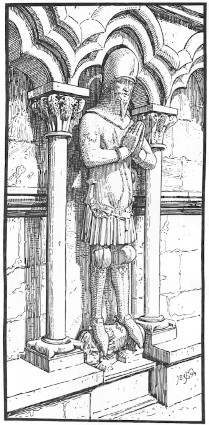 |
 |
 |
|
| Abb.1
Grabplatte des Kuno von Falkenstein in der Kirche zu Kirchzarten |
Abb.2
Herzog Bertold V. im Münster in Freiburg i.Br. |
Abb.4
Ritterrüstung, aus Stücken der Gimbel´schen Waffensammlung (Baden-Baden) rekonstruiert |
Abb.5
Ritterrüstung, aus Stücken der Gimbel´schen Waffensammlung (Baden-Baden) rekonstruiert |
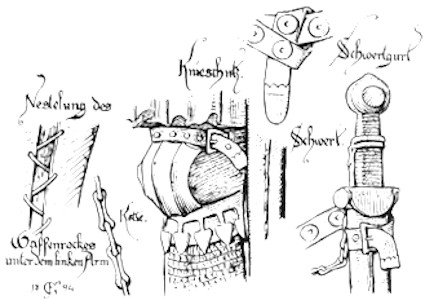 |
 |
 |
| Abb.3
Einzelheiten der Rüstung des Herzogs Berthold V. im
Münster in Freiburg i.Br. |
Abb.6
Ritterliche Tracht um 1200. (Nach einer Miniatur) Oberkörper und Kopf werden durch die lange rockartige Halsberge geschützt, an der Ärme und Kapuze angeflochten sind. Die Beckenhaube mit Naseneisen sitzt auf der Kapuze. |
Abb.7
Wappenskulptur am Treppenturme des ehemaligen St.Blasianer
Probsteigebäudes in Krozingen. (Roter Sandstein, stark
verwittert; Größe ca. 100/120cm) |